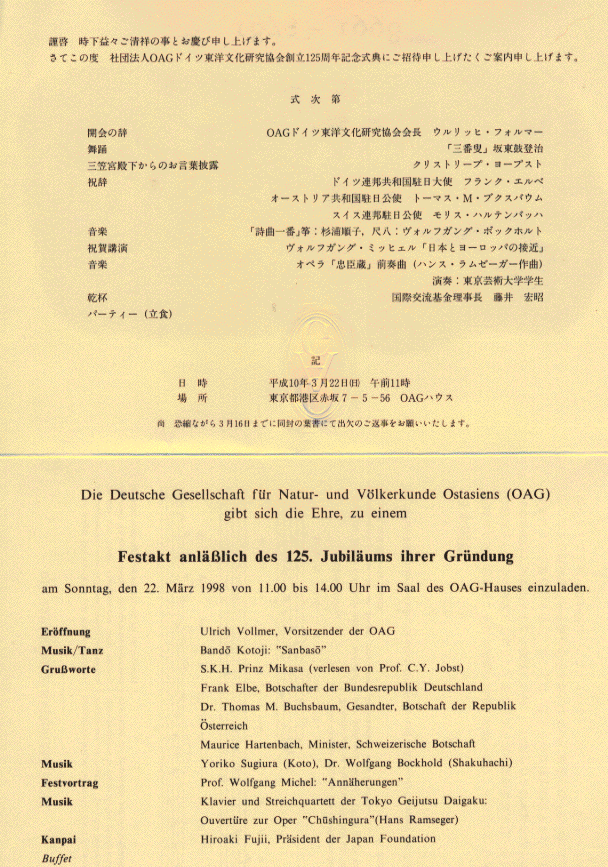Wolfgang Michel, Fukuoka
Festvortrag zum 125jährigen Jubliäum der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Tokio 21.3.1998
Sehr verehrter Herr Botschafter, Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Bitte verzeihen Sie es mir, wenn ich die obligatorischen Formeln kurz halte und mich direkt jenem Feld der interkulturellen Begegnung zuwende, auf dem vor 125 Jahren die ersten Keime dieses heute so stattlichen und tief im japanischen Boden verwurzelten Baumes »OAG« ans Licht strebten. Ich bitte Sie weiter um ihr Verständnis, wenn ich eingedenk der Reden Dr. E.Frieses zum 120. Gründungsjubiläum wie auch der durch Dr. C. von Weegmann und Dr. R.Schinzinger minutiös beschriebenen Geschichte der OAG davon absehe, die Geschicke der Gesellschaft erneut zu repetieren.
Erlauben Sie mir, statt dessen aus der Geschichte der west-östlichen Kulturbeziehungen einige Beispiele für die Bedingungen und Schwierigkeiten des interkulturellen Verstehens vorzustellen, um zum Schluß die künftigen Wirkungsmöglichkeiten der OAG ins Auge zu fassen.
»Dieses Volk [gemeint sind die Japaner] tut es allen neuentdeckten Nationen an Frömmigkeit bevor, so daß ich glaube, es gebe keine barbarische Nation, die es an natürlicher Güte übertreffe«. So begann der berühmte Indienapostel Francisco Xavier im November Anno Domini 1549 die erste Beschreibung seiner Gastgeber. Auf seiner Pionierfahrt nach Osten war er am Ende auf ein Land gestoßen, daß alle Strapazen vergessen machte. »Sie haben eine gute Gemütsart« - heißt es weiter - »und einen Abscheu vor allem Betruge [...] Sie sind zwar meistenteils arm: aber die Armut gereicht niemanden zur Schande. [...] Sie sind gegeneinander sehr dienstfertig. [...] Sie sind in der Kost sparsam und mäßig: nicht so im Trunke. [...] Die Meisten können lesen; was viel dazu hilft, daß sie die Gebetsformeln und die Hauptstücke unserer Religion leicht fassen. Sie haben jeder nur ein Weib. [...] Sie sind zu aller Ehrbarkeit ungemein geneigt, und sehr lehrbegierig. Sie hören sehr gern von Gott und den göttlichen Dingen reden: [...] Ich sah noch kein Volk weder unter den Christen, noch unter den Barbaren, das vor dem Diebstahle eine solche Abscheu hätte.«
Welcher heutige Freund Japans und welcher Japaner wäre bei der Lektüre jenes Schreibens aus Kagoshima nicht versucht, die in dieser ersten nachhaltigen euro-japanischen Begegnung aufs Papier geworfenen Worte für bare Münze zu nehmen. Nochzumal auch die mit- und nachgereisten Jesuiten viele Jahre in ihren Sendschreiben und Jahresberichten mit bunten Fäden an der prachtvollen Tapisserie weiterwebten. Welch herrliche Natur, welch edle Einwohner! Japan erscheint als Land, dem letztlich nur eines fehlt: die christliche Religion.
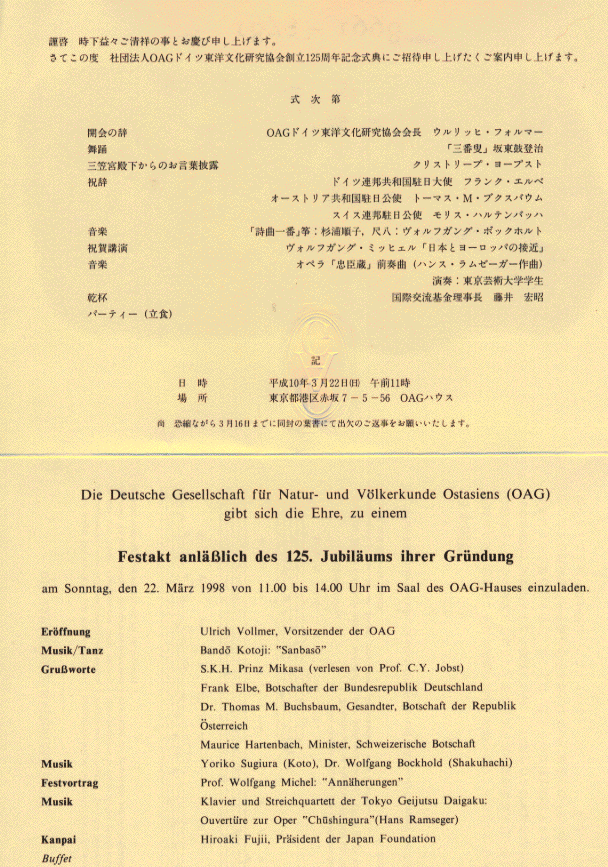
Doch anders als den Lesern des 16. Jahrhunderts ist uns inzwischen der Glaube an Gewißheit in der Wahrnehmung und Wiedergabe ausgetrieben worden. Das Blatt war schon beschrieben, noch bevor Xavier und seine Gefährten zur Feder griffen. Welch ein Glücksfall, daß die Japaner auf einem Archipel lebten! Bilder der elysischen Inseln der Antike ließen sich da evozieren, Assoziationen an ein »Ultima Thule« des Orients. Vergessen wir auch nicht die aristotelische Forderung nach Verwunderung als einem der vornehmsten Ziele der Poesie neben dem Vergnügen. Hinzu kommt der »Locus amoenus« der abendländischen Dichtung: jener fremde, wunderschöne, zum ewigen Verweilen einladende Ort, der die Christen zugleich schmerzlich an den Verlust des Paradieses erinnerte. Ähnlich wie Kolumbus hatte Xavier zum Schluß seiner langen Suche nach »Zipangu« auch einen besonderen psychischen Ort erreicht. Entdeckerstolz und Freude, poetische Traditionen, religiöse Sehnsüchte, Entzücken und praktisch-strategische Überlegungen und Hoffnungen verschmolzen zu einem enthusiatischen Japanbild.
Die Intensität des kulturellen Austausches während der folgenden Dekaden war enorm. Mit der Ausnahme Portugals und Spaniens vielleicht hat man heutzutage im Abendland leider viel davon vergessen. Deutsche waren damals nur Leser, Übersetzer, Kompilatoren; vor Ort agierten und schrieben die Lateineuropäer. Wahrscheinlich verschärfte die Langsamkeit der Medien die Erschütterung, welche die in den 80er Jahren einsetzende Unterdrückung des Christentums auslöste. Just als das katholische Europa vier Jünglinge aus Kyushu begeistert willkommen hieß, die wohl allem entsprachen, was man bis dato über Japaner vernommen hatte, just als dank »Newer Zeyttungen« und anderer populärer Medien das Wissen um die Herrlichkeit von Missionaren und Missionierten allerorten Wurzeln zu schlagen beginnt, erschüttern dramatische Nachrichten aus Fernost die gelegten Fundamente.
Ich mag an einem Tag wie heute nicht über Fehler und Gründe reden, die zum letztendlichen Scheitern der euro-japanischen Begegnung des »christlichen Jahrhunderts« führten. Wichtiger scheint mir ohnehin der Wandel in der Sichtweise. Die Reaktion nicht nur der unmittelbar Betroffenen war scharf. Die Werkzeuge zur Redefinition Japans finden wir bereits 1585 im Traktat über die »Kulturgegensätze Europa-Japan« aus der Feder des eminenten Missonars Luis Frois. Ausgrenzung, Abgrenzung und Gegenüberstellung drängen sich als Beschreibungs- und Denkfiguren in den Vordergrund. Das aus der Erschütterung und Verunsicherung quellende Verlangen nach Eindeutigkeit, nach Klarheit führt zur Reduktion der komplexen Welt Japans auf ein Inventar einfacher Elemente, die man locker zusammenschüttet und unter Kapiteln wie Männer, Frauen, Kinder, Bonzen, Eßgewohnheiten, Waffen, Pferde, Bauten, Schiffe usw. auf einem Tableau ausbreitet. Die Beschreibungen sind auf ein reimlosese Zweizeiler komprimiert, eingeleitet durch Wendungen wie »in Europa... in Japan...«, »bei uns... in Japan...«, »wir...die Japaner...«. Es verwundert nicht wenig, daß hier die Vielfalt der europäischen Sprachen, Kulturen und Gesellschaften ignoriert und ein Kontinent auf die gleiche Ebene wie Japan gestellt wird. Wenn Frois dennoch statt seiner engeren iberischen Heimat ganz Europa wählte, weckt das den Verdacht, daß er bewußt oder unbewußt an die Solidarität des christlichen Abendlandes appellierte.
Der Umschlag in so manchem Werturteil ist unübersehbar. Manches davon sollte lange zu den Grundfarben des westlichen Japanbildes gehören. Galten in den frühen Sendbriefen die japanischen Frauen noch als tugendhaft und schön, so legen sie nunmehr keinen Wert auf ihre jungfräuliche Reinheit vor der Ehe, die Töchter gehen alleine aus dem Haus, Abtreibung ist etwas Gewöhnliches. Gewandelt hat sich auch einiges am Bild des Mannes. An die Stelle des anfänglich gepriesenen Stolzes und Mutes tritt nun die Grausamkeit. Wenn sie im Kampf nicht mehr weiter kämen, begehen sie gar Selbstmord. Verrat ist so gewöhnlich, daß man schon fast gar nichts mehr daran findet. Bei Männern wie Frauen sind Geschlechtskrankheiten häufig und niemand schämt sich dessen. Dazu kommen Hinweise auf niedrige Nasen und einen kleineren Körperbau, die man in der frühen Missionskorrespondenz vergeblich sucht und gerade von Frois nach mehr als zwei Jahrzehnten in Japan nicht erwartet hätte. Von Gemeinsamkeiten, die man bei Vergleichen auch entdecken könnte, keine Spur. Der gesamte Traktatus ist auf Unterschiede und Gegensätze beschränkt. Welchen Sinn im Hinblick auf das Verständnis Japans hat jedoch z.B. die Feststellung, daß man dort mit dem rechten Fuß aufs Pferd steige und bei uns mit dem linken?
Ich erzähle das nicht, um Frois, dessen Beschreibung der japanischen Mission ich überaus schätze, etwas am Zeug zu flicken. Derartige Rezeptionsfiguren sind keineswegs seine Erfindung oder gar eine Erscheinung der Vergangenheit, Geschichte. Wie leicht ziehen wir doch heute noch gerne klare Linien! Wie schnell verfallen wir auf Muster wie »wir Deutschen ... die Japaner«! Wie oft bleibt der Blick beharrlich an Kleinigkeiten hängen, die uns absonderlich scheinen, aber wenig bedeutsam im Gesamtkontext sind? Und auch unsere japanischen Freunde und Partner haben auf Suche nach dem Wesen des Japanischen und Japaners in Vergleichen mit Amerikanern, Deutschen, Engländern, Israelis usw. usw. sehr ähnliche Erfahrungen gemacht.
Doch zurück in das ausgehende »Christliche Jahrhundert«! Mit Ausnahme der japanischen Märtyrer, deren vorbildhafte Standhaftigkeit und Glaubensfestigkeit auf süddeutschen und österreichischen Bühnen nachgespielt wurde, gab es im gewendeten Japanbild damals nicht mehr viel, was Europäer zur Aneignung verlockte. Die Rezeption fand nun eher als Addition an der Peripherie statt. Japan wurde zwar in den eigenen Horizont eingeschlossen, doch nicht assimiliert. Es blieb gesondert als einverleibter Fremdkörper.
Die ersten Deutschen betraten das Land als Angestellte der Vereinigten Ostindischen Compagnie (VOC), die im Jahre 1609 auf der westjapanischen Insel Hirado eine Handelsniederlassung einrichten durfte. In Ermangelung eines bevölkerungsreichen Hinterlandes saugen die Schiffe dieser niederländischen Aktiengesellschaft Seeleute, Handwerker, Soldaten, Abenteurer, Flüchtlinge und Kriminelle aus dem deutschen Raum auf. Ein Teil davon gelangte bis nach Japan. Niedere Chargen, von den Niederländern als “nicht qualifiziertes Personal” summiert, hatten keinen Namen, und so ist die Schar der identifizierbaren deutschen Landsleute bis zur Anfang des 18. Jahrhunderts nicht allzu groß:
Michael Hohenreither, Christoph Fernberger, Wolfgang Braun, Caspar Schamberger, Hans Hancko, Hans Pauts, Jürgen Henselingh, Jürgen Andersen, Karl Kempf, Bartolomäus Hoffman, Johann Jacob Mercklein, Johannes Wunsch, Heinrich Muche, Christoph Frik, Johann Konrad Rätzel, Zacharias Wagner , Andreas Cleyer, Georg Meister, Jan Barentsz, Hans Jürgen Keijserling.
Wie interessant und verdienstvoll im Einzelnen die Aktivitäten dieser Landsleute gewesen sein mögen, an der Fortführung des westlichen Diskurses über Japan hatten sie keinen nennenswerten Anteil. So mangelte es nach der Vertreibung der Iberer und dem erzwungenden Umzug der niederländischen Compagnie in die streng überwachte Faktorei Deshima (Dejima) an neuem Stoff. Ein Blick auf einschlägige Bibliographien genügt, um festzustellen, daß man sich die aus erster Hand stammenden Publikationen bis zur Öffnung Japans im 19. Jahrhundert an den Fingern abbzählen kann.
Gewiß spielte hierbei die eingeschränkte Informations- und Bewegungsfreiheit der Europäer eine Rolle. Rousseau sah das allerdings anders und machte den Kaufleuten den Vorwurf, sie würden in Ostindien nur ihre Geldsäckel, nicht aber die Köpfe füllen. Wenn dem generell so wäre, säßen wir heute wohl nicht unter dem mächtigen Dach dieser wesentlich von Kaufleuten begründeten und bewahrten Gesellschaft beisammen. Rousseaus Topf hielt auch damals das Wasser nicht. Wer immer einmal einen Blick in die reichen Bestände an Briefen, Berichten, Beschlüssen, Diensttagebüchern und Übergabepapieren der Handelsniederlassung Deshima getan hat, ist überrascht von der Fülle an landeskundlichen Informationen, aus der noch Generationen von Historikern schöpfen können. Der »kaufmännische Blick« fiel nicht selten auf japanische Begebenheiten, Personen, Ereignisse, zu denen sogar einheimische Quellen nichts oder nur wenig vermelden. Daß die Compagnie dieses Wissen, diese monopolartige Position nicht ohne Not aus aufgeben mochte, ist verständlich. Man wußte in Batavia sehr gut über das Gastland Bescheid, und da man weder an eine Eroberung dachte, noch mit einer wesentlichen Veränderung der Lage durch die japanische Seite zu rechnen hatte, war der Blick erfreulich nüchtern.
In Europa wurde der Markt daher geraume Zeit von persönlichen Reisebüchern beherrscht. Davon gab es nicht wenige. Das, was wir kennen, ist wohl nur der kleine Rest. Schiffsunglücke, Kriege, Brände und interesselose Erben reduzierten die Zahl der Handschriften erschrecklich. Ein Reisebuch befriedigte die Eitelkeit, den Stolz des Autors ebenso wie das Interesse der curieusen Leserschaft an unterhaltsamen, exotischen Begebenheiten aus der weit gewordenen Welt. Japan ist meist nur eine unter vielen Stationen. Erlebtes, Gehörtes, Gelesenes, Glauben, Hoffnung und Wünsche vermischten sich in diesem Genre besonders heftig.
Der Aufbruch zu einer nicht an zeitliche Abläufe oder erzählerische Prinzipien gebundenen, systematischen Darstellung setzt nach einem Präludium durch den Deutschen Bernhard Varen mit dem Werk des Lemgoer Pfarrersohns Engelbert Kaempfer ein. Er, dazu der Schwede C.P. Thunberg, der Niederländer I.Titsingh und der Würzburger Ph.F. von Siebold gelten aufgrund ihrer Schriften und ihres Einflusses in Europa als Säulen der neuzeitlichen Erkundung Japans. Mit der Ausnahme Titsinghs waren sie als Ärzte in der Handelsniederlassung Deshima tätig. Dank ihrer von den Japanern hochgeschätzten Profession hatten sie mehr Bewegungsfreiheit und Informationsmöglichkeiten als das kaufmännische Personal.
Die nach meinem Dafürhalten größte persönliche Leistung erbrachte Kaempfer. Seine unter überaus widrigen Umständen und ohne nennenswerte Vorbilder erarbeiteten Schriften setzten den Maßstab. In ihnen behandelt er neben der Geschichte, Geographie, Kultur, Gesellschaft, dem Außenhandel und den Handelsbeziehungen auch die japanische »Abschlußpolitik« und die Gesetzgebung des Tokugawa-Regimes. Kaempfer war atpyisch in der räumlichen wie auch der geistigen Annäherung an Japan. Dank seiner Erfahrungen in vielen anderen außereuropäischen Kulturen vermochte er sich von verfestigten Darstellungsmustern frei zu machen. Diese seinerzeit außergewöhnliche Haltung zusammen mit dem Streben nach Vollständigkeit und Präzision machte ihn zu einem Pionier der wissenschaftlichen Länderkunde.
Kaempfers Beispiel zeigt uns, daß jedes tiefere Verständnis einen unmittelbaren, engen Austausch voraussetzt. Als bloßer Beobachter wäre er in jenen zwei Jahren von 1690 bis 1692 nicht weit gekommen. Doch er ließ sich auf Japan ein, ging auf die Gegenseite zu und fand in seinem »Assistenten« Imamura Gen’emon einen würdigen Partner. Dies war keineswegs selbstverständlich. Zwei Jahrzehnte vor Kaempfers Japanaufenthalt hatte die Compagnie in der Person Willem ten Rhijnes erstmals einen promovierten Arzt nach Deshima geschickt, weil man glaubte, der Shogun habe nach einem richtigen Gelehrten verlangt. Ten Rhijnes Dolmetscher waren kluge Menschen. Motoki Sho-dayus Name steht in vielen Nachschlagewerken zur Geschichte der japanischen Medizin, und auch Iwanaga So-ko- galt als ein im Konfuzianismus und in der Heilkunde beschlagener Mann. Man bedrängte den jungen, hochgebildeten Doktor mit langen Listen von Fragen. Doch ten Rhijne verstand nicht oder wollte nicht verstehen, hielt dies alles für wirr, primitiv, für eine Verschwendung seiner kostbaren Zeit. Als er sich seinerseits dann chinesische Texte zur Akupunktur erklären ließ und Verständnisprobleme bekam, bemängelte er die unzureichenden Holländischkenntnisse der beiden. Sprachunterricht, wie Kaempfer ihn gab, kam ihm nie in den Sinn. Lieber füllte er die Ablagen der Compagnie mit langen schriftlichen Klagen über mangelnde Anerkennung und Ehrerbietigkeit der Japaner. Und so erbrachte diese Begegnung für beide Seiten zwar die eine und andere Erkenntnis - dem Westen z.B. das Wort »Akupunktur« - doch bei weitem nicht jenen reiche Ernte, die Kaempfer und Imamura für ihre Heimatländer einfuhren.
Am Beispiel Kaempfers erinnern wir uns weiter daran, daß der Berichterstatter, und sei er noch so sehr um so etwas wie Sachlichkeit, Verständnis und Präzision bemüht, keineswegs das Japanbild in seiner Heimat entscheidet, ja dort bisweilen zum bloßen Stichwortgeber für andere Debatten dient.
Die Namen der Rezipienten Kaempfers sind imposant: Kant, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot und d’Alembert. Besonders gerne wurde er zitiert, wenn es um Fragen der staatlichen Verfassung, der Religion(sfreiheit) sowie der historischen Entwicklung der Menschheit ging. Hier lieferte Japan den Aufklärern reichlichen Stoff zur Unterfütterung ihrer jeweiligen Sicht. Kaempfer war der Abschluß des Landes und das scharfe Regime vom geschichtlichen Hintergrund her verständlich. Demgegenüber meinte Montesquieu - wohl mit Blick auf die von Kaempfer beschriebenen strengen Gesetze und geographisch-klimatischen Konditionen - daß Staatsgewalt in Asien stets despotisch sei und die japanischen Gesetze »alle Ideen menschlicher Vernunft auf den Kopf« stellten. Dies rief wiederum Voltaire auf den Fechtboden. Ihm zufolge richtete sich der »vernünftigste Teil« der japanischen Nation ebenso wie der Sho-gun nach den - auch in Europa geschätzten - Regeln des Konfuzianismus. Im Gegenteil, Japan habe »das Gesetz der Natur ausdrücklich in bürgerliche Gesetze« verwandelt.
Auch in den Belles Lettres, besonders der fiktiven Reiseliteratur, plünderte man Kaempfer nach Belieben aus. Diese neue literarische Gattung nutzte exotische Schauplätze und Figuren, um innereuropäische Probleme zu diskurieren. Einen emotional spannungsreichen Stoff bot z.B. Kaempfers Schilderung der Audienz im Schloß zu Edo. Die ihm abverlangten Darbietungen waren allerdings durch den Tod des Sho-gun Tsunayoshi schon vor dem Druck der »History of Japan« (1727) aus der Welt. Doch nicht nur Oliver Goldsmith, Marquis d’Argens, Matthias Claudius und andere Autoren waren von dieseSzene gefesselt. Weit über hundert Jahre später atmete sogar ein Forscher wie Siebold nach seiner Audienz im Schloß erleichtert auf, daß die »von Tanzen und Singen begleitete Privatvorstellung der Niederländer« »inzwischen abgeschafft worden« sei.
Kaempfer stellte, so wie Xavier die Japaner als ein Volk dar, das »an Sitten, Tugenden, Künsten und feinem Betragen« allen anderen Völkern überlegen sei. Doch dem mochte im 18. Jahrhundert kaum jemand zustimmen. Europa habe, so Voltaire, die verlorene Zeit wieder nachgeholt. In der jetzigen Stufe der Kultur, führt Herder aus, sei in Japan ebensowenig wie in China an einen Fortschritt zu »feinern Wissenschaften, wie sie Europa treibt« zu denken. Die »Deutsche Enzyklopädie« von 1791 findet die Gründe dafür, daß die Japaner in der Aufklärung nicht weiterkämen, darin, daß ihnen aller Umgang mit Fremden untersagt sei.
Der Reiz Japans hat merklich nachgelassen; man kann an diesem Land nichts mehr entdecken, was von Bedeutung für das Selbst- und Weltverständnis Europas wäre. Gegen Ende jenes Jahrhunderts faßt der deutsche Historiker C. Meiners die Japaner und Chinesen zu einer »altaischen Rasse« von »thierischer Reizbarkeit« und »ungewöhnlicher Gefühllosigkeit« zusammen. Sie hätten einen »Mangel an Erfindungskraft« und könnten »nur nachahmen, nicht aber erfinden”, da ihnen »derjenige Grad von Verstand und Vernunft« fehle, den man »zur Erlernung und Erweiterung von Wissenschaften und Künsten« benötige.
Das Schicksal der Kolonialiserung blieb Japan erspart, nicht aber der Orientalismus des Westens. Die der europäischen Rationalität, Tugendhaftigkeit und Reife gegenübergestellte angebliche Irrationalität, Unreife, Tugendlosigkeit und Ambiguität des Orientalen findet sich auch im Diskurs über Japan wieder. Der japanische Intellekt galt als »unterentwickelt« bzw. »in der Entwicklung begriffen«. Der westlichen Logik fand ihr Pendant in der angeblich unzulänglichen japanischen Intuition, der Individualität stand das Gruppenbewußtsein gegenüber, der Originalität das Nachahmen.
Allerdings brach das Land im 19. Jahrhundert aus dieser zugewiesenen Rolle aus. Mit der Öffnung entstand eine neue Qualität der Beziehungen und Sichtweisen. In diesen Zeiten des heftigen Umbruchs und Wandels wurde die »Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde« geboren. Auch Angehörige anderer Nationen des Westens spüren ein solches Bedürfnis nach systematischer Erkundung und Neuorientierung. Denken wir hier nur an die 1872 gegründete »Asiatic Society of Japan«. Beeindruckend in Europa der Versuch von Leon de Rosny, auf seinem 1. Internationalen Orientalistenkongress in Paris (1873) die Fundamente für einen gleichberechtigten wissenschaftlichen Austausch und Dialog zu legen. Die Beziehungen waren ja nicht ganz so einseitig, wie es heute scheint. Der Einfluß des Japonismus endete keinesweg in Ölbildern und »Art Nouveau«, sondern wirkte nach bis in die architektonischen Konzepte des »Bauhauses« und anderen Richtungen des Funktionalismus. Und wer weiß heute noch vom starken Interesse Italiens und Frankreichs an der japanischen Raupenzucht und Seidenindustrie?
So sehr man die Modernisierungsbemühungen als Bestätigung der Überlegenheit westlicher Technik und Zivilisation zur Kenntnis nahm, so sehr bedauerten paradoxerweise nicht wenige Europäer das Schwinden des »alten«, »wahren« Japans. Besonders Schriftsteller und schriftstellernde Reisende mochten bis in die jüngste Vergangenheit vom Objekt ihrer Sehnsüchte nicht ablassen.
Siebolds »Nippon« war das letzte von einer Person repräsentierte Japanprojekt. Dr. E. Friese hat vor fünf Jahren an dieser Stelle eine eingehende Würdigung gegeben. Die Positionsbestimmung des Landes nach der Öffnung jedoch überstieg nicht nur die Kräfte eines Einzelnen. Durch die vielfältigen und direkten Kontakte, durch das Vordringen Japans auf den Weltmärkten, durch Diplomatie, Presse, Wissenschaft u.a.m. meldeten sich vielerlei Stimmen gleichzeitig. Von isolierten deutsch-japanischen Wechselwirkungen zu reden, fällt nach der Meiji-Reform nicht weniger schwer als vorher.
Welche Verengung des Geistes der Ausschluß dritter Nationen aus interkulturellen, aus internationalen Kontakten bedeutet, haben uns die zwölf Jahre bis 1945 gezeigt. Die noch heute in vielen Köpfen steckende deutsch-japanische Affinität war keineswegs naturgegeben. In der Ideologie des Nationalsozialismus saß das japanische Volk ursprünglich auf keinem guten Platz. Hitler selbst wählte in »Mein Kampf« ausgerechnet Japan als Beispiel, um den Unterschied zwischen »kulturschöpfenden” und »kulturtragenden« Völkern zu veranschaulichen. Nach 1936 und dem deutsch-japanischen Kulturabkommen von 1938 wurde das aber rasch übertüncht und mit den Mitteln der Massenpropaganda innerhalb kurzer Zeit ein einheitliches Japanbild unter der Bevölkerung verbreitet. Großen Einfluß übte dabei die These des ehemaligen Majors und Geopolitikers Karl Haushofer von der Zwiespältigkeit der japanischen Kultur aus, die in den schroffen Gegensätzen der Natur begründet sei (»Japan und die Japaner«, 1923). Das über den Japonismus transportierte sanfte Japanbild wurde ergänzt durch ein kriegerisches Element. Bücher wie Sieburgs »Die stählerne Blume« (1939) oder Appelius' »Kanonen und Kirschblüten« (1943) sind bis in den Titel vor dieser dualistischen Sicht geprägt.
Zum Alltag der Bevölkerung findet man bis zur Mitte unseres Jahrhunderts wenig. Zu den raren Ausnahmen zählt »Eines Arbeiters Weltreise«, 1913 publiziert von Fritz Kummer. Er erlebte Japan als »Land der prächtigsten Landschaften und der schmutzigen Städte«. Zu ähnlichen Ergebnissen kam ein halbes Jahrhundert später fest jeder, der zur Schreibmaschine schritt. Mit dem erneuten wirtschaftlichen Aufschwung und den Exporterfolgen nach dem Zweiten Weltkrieg tauchte dann das Bild der Gefahr aus dem Osten auf - wieder einmal. So wie die Mongolen 1243 an der Liegnitz die Regeln des »ritterlichen Kampfes« mißachtet hatten, so sah man nun die Regeln eines »fairen« Welthandels durch Japan mißachtet. So wie sich Deutschland Anfang dieses Jahrhunderts beklagte, daß Japan trotz deutscher Hilfe bei der Modernisierung sehr undankbar sei, so beklagen sich nun die Industrienationen im Chor über den fernöstlichen Wirtschaftsegoismus. Autoren meldeten sich zu Wort, die im Fernen Osten »100 Millionen Außenseiter« entdeckten und das Land erneut an den Rand der zivilisierten Völkergemeinschaft schoben. Viele Argumentationsfiguren glichen auf beunruhigende Weise denen der Portugiesen nach ihrer Vertreibung damals vor vier Jahrhunderten.
Viele Presseorgane waren ebenfalls nicht zimperlich. Da man die japanische Wirtschaft nicht mehr ignorieren konnte, griff man nun vorzugsweise die Schattenseiten des Landes auf: die Wohnsituation, Umweltverschmutzung, die Uniformität der Erziehung, die Lage der Minderheiten, die Steinwüste To-kyo- und anderes mehr. Gewiß kamen da auch tatsächlich bestehende Probleme zur Sprache, und gegen einzelne Artikel läßt sich oft nicht viel einwenden. Bedenklich stimmte jedoch die Fixierung auf einen bestimmten Themenkatalog.
Japan reagierte in der Form einer »Japaner-Theorie« (Nipponjin-ron). Über Kulturvergleiche, die nicht zufällig an jenen Froisschen Traktatus von 1585 gemahnen, bestätigte man ein ums andere Mal seine Einzigartigkeit, Tiefe und Schwerverständlichkeit. Dieser wohl aus einer großen Verunsicherung heraus aufgetürmte ideologische Wall schützte nun zwar einerseits, andererseits isolierte er auch das Land.
Lange sah man sich als Opfer ausländischer Kampagnen und reagierte mit Vorwürfen, der Westen bemühe sich nicht um Objektivität und korrekte Informationen. Doch ganz abgesehen davon, ob es so etwas überhaupt gibt: Ich glaube, daß die Art der Information nicht darüber entscheidet, wie das Bild einer fremden Kultur und Gesellschaft letztlich ausgemalt wird. Unsere Erziehung, Sozialisationsgeschichte, die aktuelle Lage, allerlei Ängste, Sehnsüchte und Ziele durchdringen alle Vorstellungen, die wir uns von Kulturen und Menschen machen. Selbst den seltenen Fall, daß unser Selbstverständnis, unser Selbstportrait mit jenem Bild übereinkommt, das andere von uns entworfen haben, halte ich für tückisch. Denn wer sagt uns, daß da nicht nur zwei zufällig zusammenpassende Stereotypmuster vorliegen?
Was schützt uns heute vor Exotismus, vor Auto- und vor Heterostereotypie, vor Vorurteilen und Projektionen, vor Instrumentalisierung und Propagandismus? Nun, wichtig scheint mir vor allem, daß man versucht, die Bedingungen der eigenen Wahrnehmung zu erkennen, daß man die Quellen der Informationen möglichst streut, um sich aus Abhängigkeiten zu lösen, und schließlich, daß man nicht nachläßt, vielfältige und direkte Kontakte zu knüpfen.
Die Bedingungen hierfür sind vor der Wende zum 21. Jahrhundert günstiger denn je zuvor. Die wechselseitigen Abhängigkeiten und praktischen Erfordernisse in einer eng gewordenen Welt machen Abgrenzungen und Rückzug schwieriger. Der »Fremde«, dessen Konturen Georg Simmel einst zwischen den Polen der räumlichen Nähe und kulturellen Ferne, der allgemein menschlichen Nähe und individuellen Ferne, zwischen Verweilen und Wandern so brilliant umriß, gewinnt überraschende neue Dimensionen. Neue Medien lassen Raum und Zeit schrumpfen, der Austausch wird schnell und unmittelbar. Wer die diesbezüglichen Homepages besucht oder einen Blick in die Newsgroups, Chatrooms oder Mailing-Listen des Internets wirft, erkennt, daß die Ära der Deutungsmonopole zu Ende geht. Der Selbstmord eines japanischen Ministerialbeamten löst binnen Stunden einen über Kontinente laufenden Austausch über Schuld und Sühne aus. Eine Episode über das Anrempeln auf der Straße in Tokio führt zur Debatte über Körperlichkeit, Raumkonzepte oder mögliche rassistische Aspekte.
Eines wird auf diesen globalen Marktplätzen schnell bewußt. Die Wahrheit hält niemand in den Händen. Sie ergibt sich auch nicht als kleinster gemeinschaftlicher Nenner. Nach wie vor kommt wissenschaftlicher Analyse ein vorrangiger Platz zu. Wir erkennen aber besser denn je zuvor, wie wichtig und nützlich der permanente Widerspruch ist, um die Grenzen und Besonderheiten unserer eigenen Position zu bestimmen. Dies macht vorsichtig gegenüber schnellen Urteil - und hoffentlich auch bescheiden.
Die OAG, deren Jubliäum wir heute feiern, hat durch ihre Vorträge, Publikationen, Reiseprogramme und Ausstellungen, in Seminaren, Festen und Feiern eindrucksvolle Beiträge zum besseren Verstehen Japans, zur Förderung des Austausches und der Begegnung geleistet. Für die ersten drei Jahrzehnte ihrer Geschichte waren die »Mitteilungen der OAG« faktisch das einzige Forum der deutschen Japankunde, und auch heute, nachdem die Erforschung Japans in vielen Instituten und Institutionen einen erregenden Aufschwung verzeichnen kann, behauptet sie mit gutem Grund ihren prominenten Platz. Diese bewährten Aktivitäten gilt es zu pflegen und fortzuentwickeln. Zugleich liegt meines Erachtens in den neuen Medien das Feld, auf dem die Gesellschaft dank ihrer Reputation, Kapitalkraft und Lage vor Ort Pionierarbeit leisten, neuen Lorbeer und eine noch breitere Wirkung in internationalen Dimensionen erringen könnte. Die Anfänge sind ja bereits getan und erfreulich. Wünschen würde ich mir darüber hinaus allgemein zugängliche elektronische Publikationen, desweiteren die Bereitstellung elektronischer Datenbanken und Hilfsmittel sowie die Einrichtung von Internet-Diskussionsforen (Mailing-Listen, Chatrooms). Mag sein, daß dabei vielleicht das eine oder andere spezifisch deutsche Element ein wenig in den Hintergrund tritt und auch das Umfeld Japans stärker ins Blickfeld rückt. Von Schaden wäre das im Zeitalter der Globalisierung nicht, nochzumal schon die Gründerväter vor 125 Jahren als Objekt ihrer »Natur- und Völkerkunde« ganz »Ostasien« im Auge hatten.
|